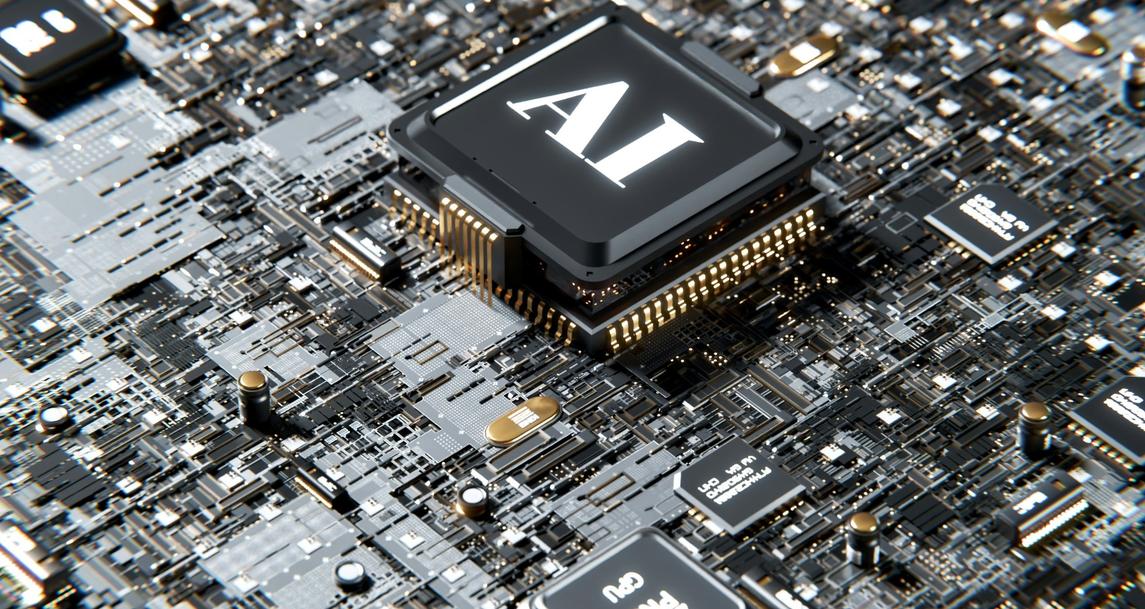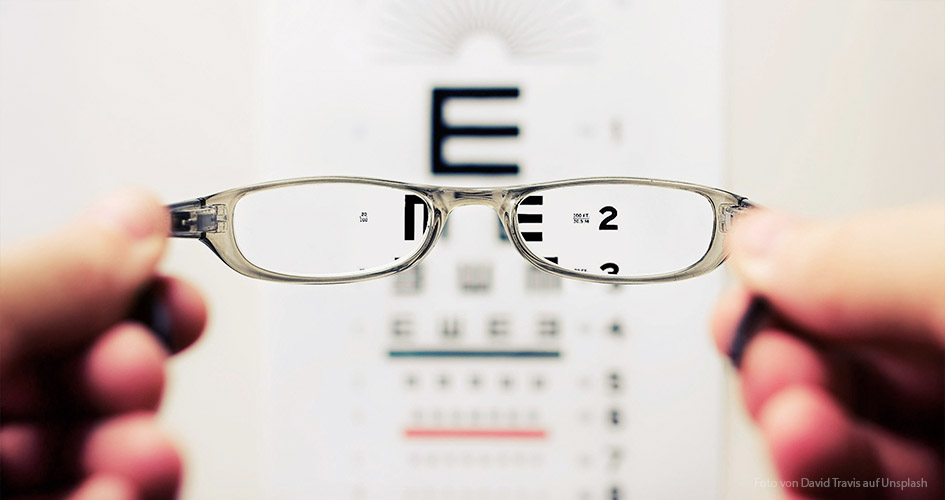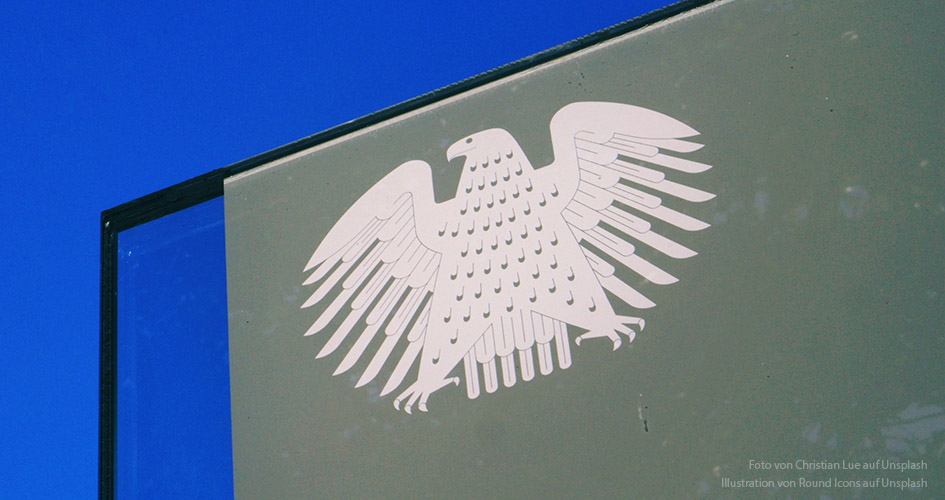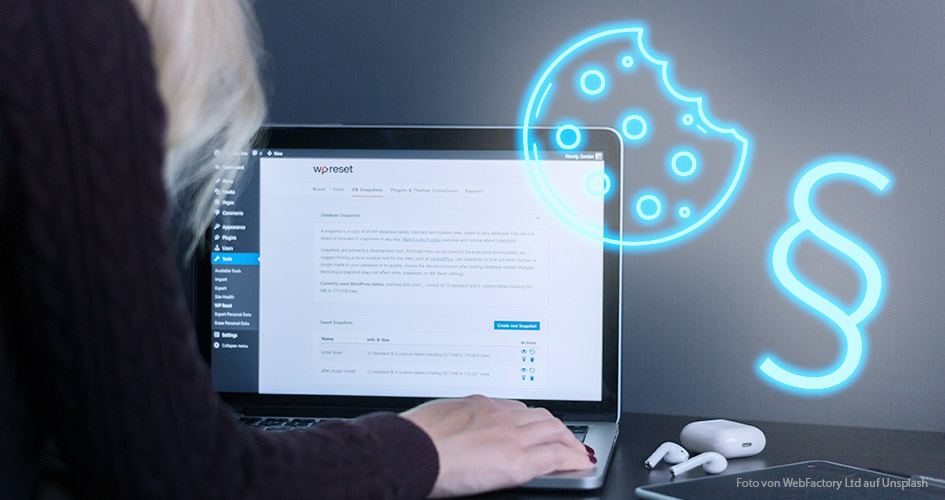Was beinhaltet das neue Pflegeunterstützungs- und entlastungsgesetz?
Das neue Pflegeunterstützungs- und entlastungsgesetzt (PUEG) wurde in 3. Lesung am 26. Mai 2023 verabschiedet und am 01. Juli 2023 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Es hat in erster Linie eine Leistungsverbesserung für Pflegebedürftige und ihre Angehörigen zur Folge. Darüber hinaus wird die finanzielle Lage der Pflegeversicherungen stabilisiert, die Arbeitsbedingungen für beruflich Pflegende verbessert und die Digitalisierung in der Langzeitpflege gestärkt.
Auswirkungen im Bereich des Datenschutzes
Für die beitragsabführende Stelle hat das PUEG diverse datenschutzrechtliche Auswirkungen.
Hinweis: Die beitragsabführende Stelle ist regelmäßig der Arbeitgeber. Lediglich bei Selbstzahlenden wird diese Aufgabe von der Pflegekasse wahrgenommen. Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich daher primär auf Arbeitgeber und ihre Mitarbeitenden.
Gemäß § 55 Abs. 3 S. 6 PUEG müssen von dem Mitarbeitenden sowohl die Elterneigenschaft als auch die Kinderanzahl (ausschließlich Kinder unter 25 Jahren) gegenüber der beitragsabführenden Stelle nachgewiesen werden, sodass der Arbeitgeber folglich neben den bereits bestehenden personenbezogenen Daten, weitere Daten des Mitarbeitenden verarbeitet. Dies ist jedoch nur dann notwendig, wenn die Angaben der beitragsabführenden Stelle nicht bereits vorliegen.
Als Nachweise kommen mehrere Möglichkeiten in Betracht. Die beitragsabführende Stelle kann selbst über die Art und Form der Nachweismöglichkeit entscheiden.
Möglichkeiten der Nachweiserfassung
Der GKV-Spitzenverband hat eine Liste mit Nachweismöglichkeiten als Orientierungshilfe veröffentlicht, an welcher sich beitragsabführende Stellen orientieren können.
Als geeigneter Nachweis gelten demnach z.B. Geburtsurkunden, Erziehungsgeld- oder Elterngeldbescheide, Einkommenssteuerbescheide (Kinderfreibetrag) oder Abstammungsurkunden.
Ferner kommen grundsätzlich verschiedene Meldemöglichkeiten zwecks Erbringung des Nachweises an die beitragsabführende Stelle in Betracht. Folgende Möglichkeiten könnten in der Praxis herangezogen werden:
- Die digitale Meldemöglichkeit
- Die analoge Meldemöglichkeit
- Die Meldung per Selbsterklärung
Bisher gibt es noch kein digitales Verfahren zur Nachweiserbringung. Gemäß § 55 Abs. 3c SGB XI soll ein solches Verfahren jedoch bis zum 31. März 2025 zur Verfügung gestellt werden, um die notwendigen Angaben zu erfassen und das Verfahren für alle Beteiligten zu vereinfachen.
Bis dahin (01. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2025) gilt deshalb das sogenannte vereinfachte Nachweisverfahren.
Im Rahmen des vereinfachten Nachweisverfahrens erfolgt die Meldung per Selbsterklärung. Hierfür ist es gem. § 55 Abs. 3d SGB XI ausreichend, wenn sich der Arbeitgeber die Angaben zu den berücksichtigungsfähigen Kindern mitteilen lässt. Eine weitergehende Prüfung durch Vorlage von geeigneten Nachweisen, ist hingegen nicht erforderlich. Es stellt damit daher die wohl derzeit datensparsamste Nachweismöglichkeit dar.
Sofern sich die beitragsabführende Stelle dennoch dafür entscheidet, sich die Nachweise vorlegen zu lassen, ist Folgendes zu beachten:
Nachweise sollten bestenfalls analog (per Post oder persönlich an die entsprechende Abteilung/Person im Unternehmen) übermittelt werden. Arbeitgeber sollten Mitarbeitende darauf hinweisen, dass die Nachweise keinesfalls per unverschlüsselter E-Mail versendet werden sollten.
Sofern eine Übermittlung per E-Mail dennoch gewünscht ist, sollte diese zumindest verschlüsselt werden oder die Datei als verschlüsselte ZIP-Datei übermittelt werden. Alternativ können den Mitarbeitenden zwecks Übermittlung der Nachweise auch sichere virtuelle Datenräume zur Verfügung gestellt werden (z.B. „FTAPI“).
Die Speicherung und Verarbeitung der Nachweise selbst wird durch Art. 6 Abs.1 lit. c) DS-GVO legitimiert.
Aufbewahrungspflicht
Die erbrachten Nachweise, darunter fallen auch die übermittelten Angaben im Wege des vereinfachten Nachweisverfahrens, unterliegen einer Aufbewahrungspflicht.
Die Unterlagen und Mitteilungen (bzw. Vermerke über die Mitteilung) müssen bis zum Ende des Versicherungsverhältnisses, welche die Beitragszahlung begründet, und darüber hinaus weitere vier Kalenderjahre aufbewahrt werden.
Nach Ablauf der Aufbewahrungspflicht sind die personenbezogenen Daten gem. Art. 17 Abs. 1 lit. a) DS-GVO zu löschen.
Fazit
Informieren Sie ihre Mitarbeitenden über die neuen Gesetzesänderungen und die damit einhergehende Nachweiserbringung.
Weisen Sie darauf hin, dass die Nachweise, solange die Möglichkeit noch besteht, per Selbstauskunft, auf dem anlogen Wege, z.B. per Post oder persönlich bei der zuständigen Abteilung oder durch verschlüsselte Onlineübermittlung erbracht werden sollten. Weisen Sie ferner darauf hin, dass für die Übermittlung des Nachweises keinesfalls ein Chatanbieter oder unverschlüsselter E-Mail-Versand genutzt werden sollten.