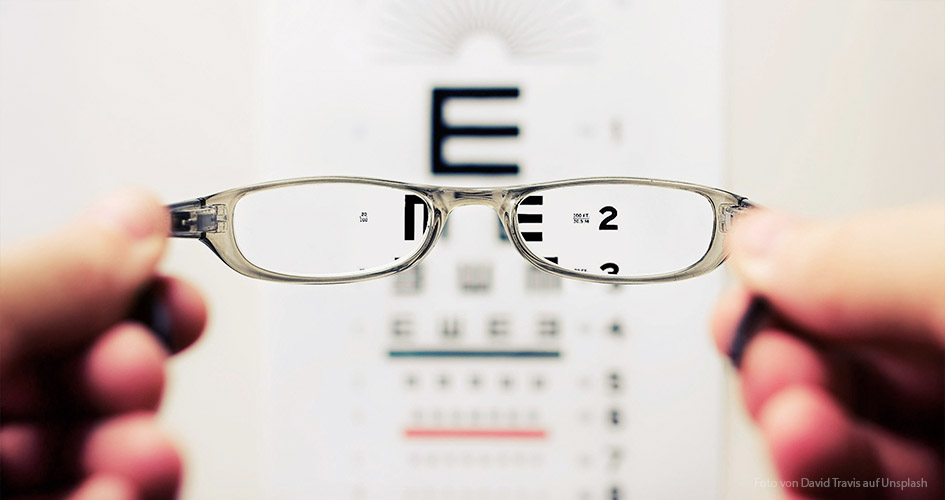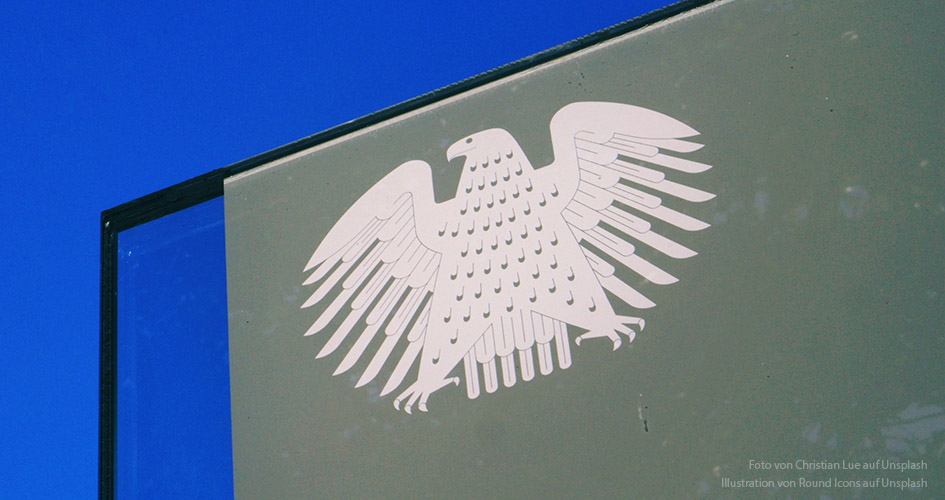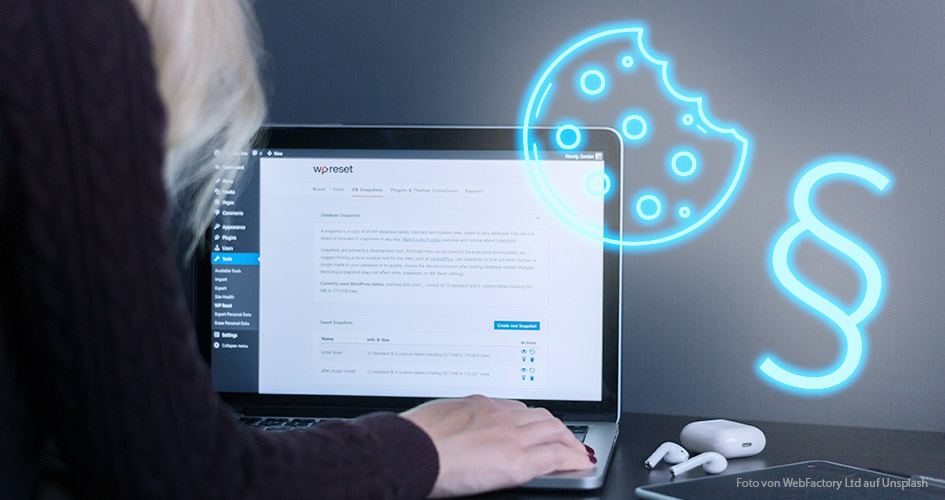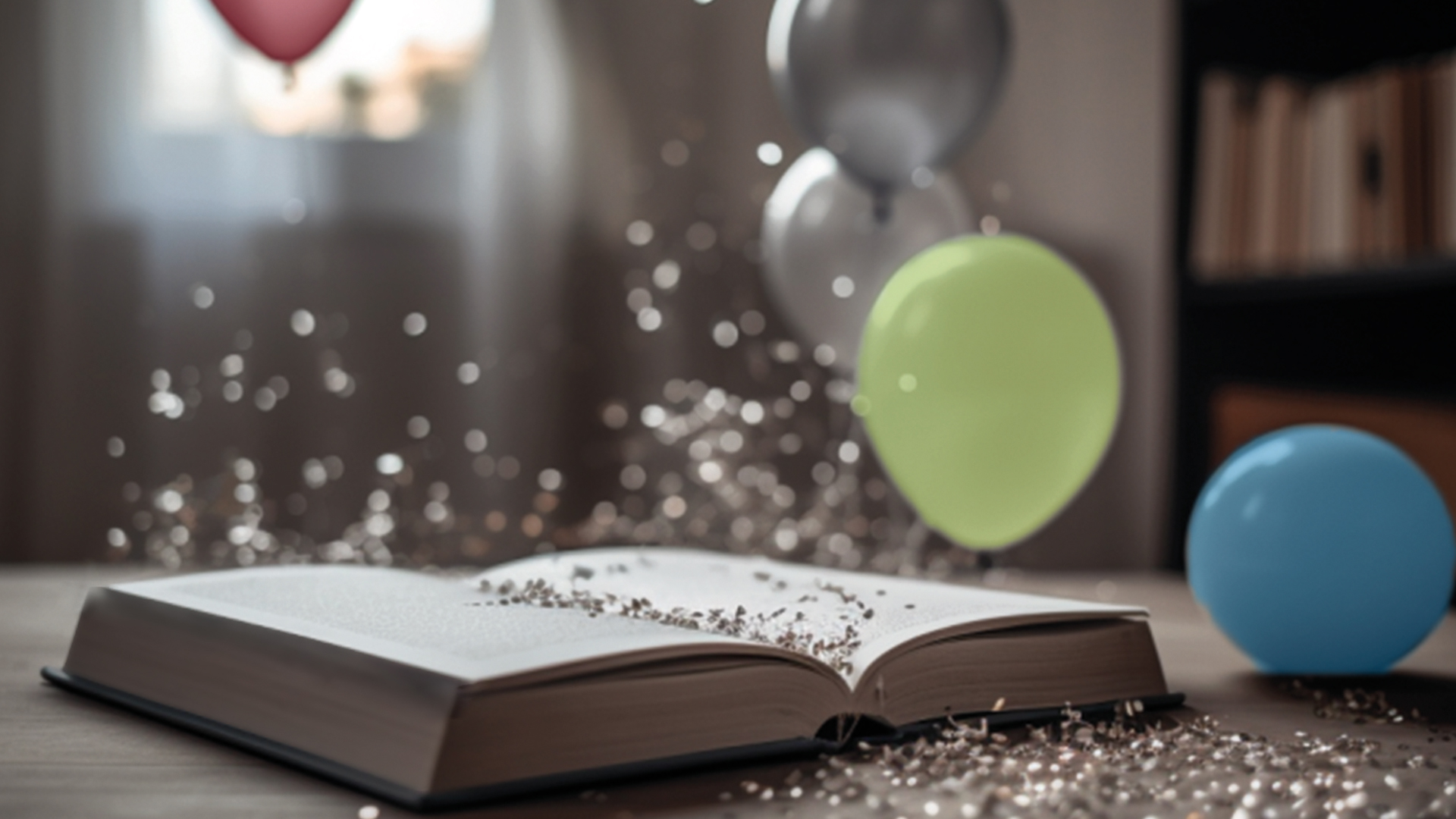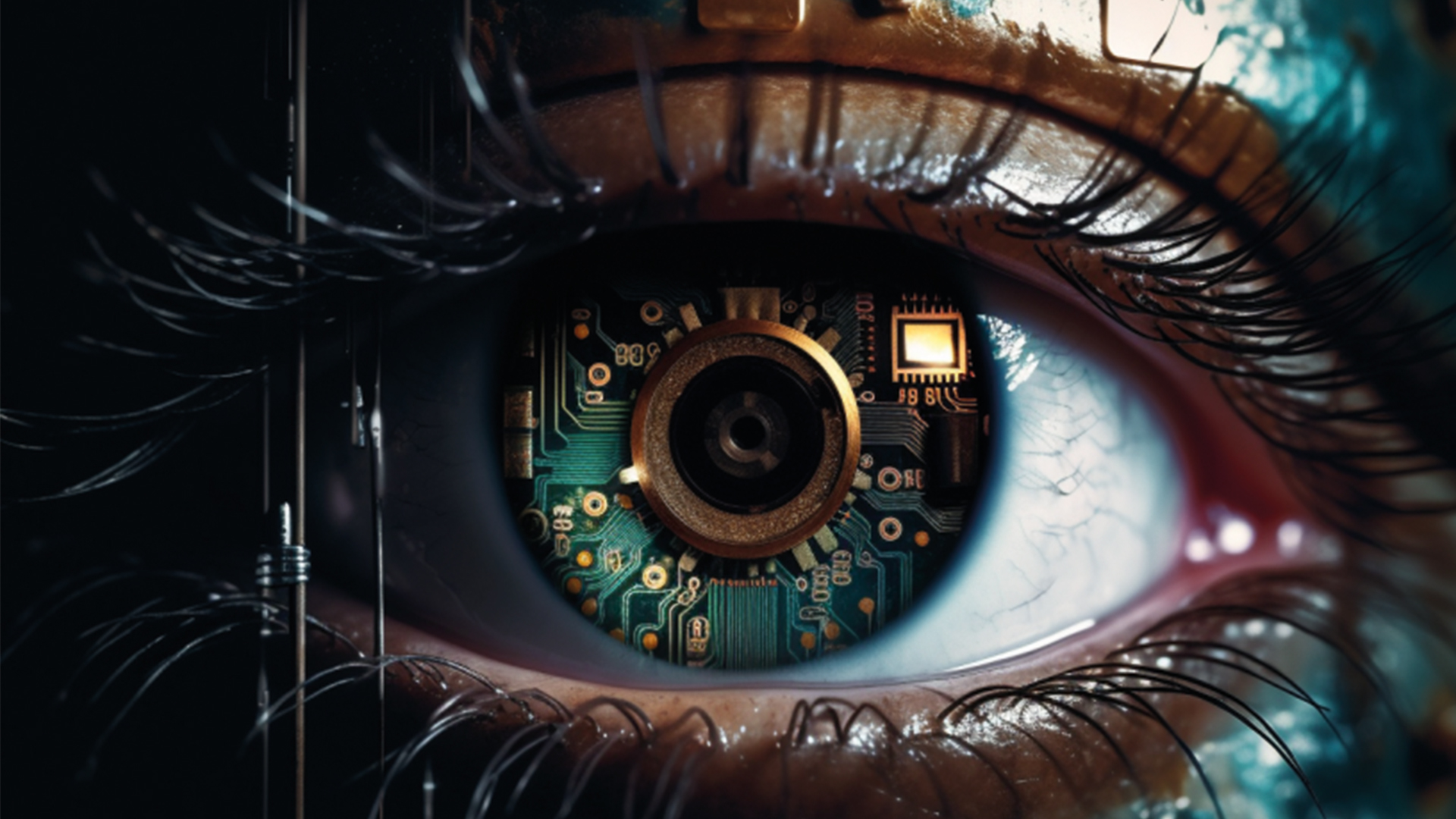Der Fall: IG BCE gegen Adidas
Im Mittelpunkt des Verfahrens stand die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE), die vom Sportartikelhersteller Adidas in Bayern die Herausgabe der dienstlichen E-Mail-Adressen seiner rund 5.400 Beschäftigten forderte. Alternativ verlangte sie einen Zugang zu internen Kommunikationsplattformen wie Microsoft Viva Engage oder einen Link zu ihrer Webseite im Intranet des Unternehmens. Ziel war es, digitale Zugänge für die Mitgliederwerbung zu schaffen – ein Ansatz, den die Gewerkschaft als notwendige Anpassung an die moderne Arbeitswelt ansieht.
Die Vorinstanzen sowie das BAG wiesen die Klage jedoch ab. Das Gericht stellte klar, dass ein solcher Anspruch weder durch geltende Gesetze noch durch die von Art. 9 Abs. 3 des Grundgesetzes (GG) garantierte Koalitionsbetätigungsfreiheit gestützt werden könne (BAG, Urt. v. 28.01.2025, Az. 1 AZR 33/24).
Die rechtliche Abwägung: Grundrechte im Konflikt
Das BAG betonte, dass die Entscheidung eine Abwägung zwischen den widerstreitenden Grundrechten erfordere. Auf der einen Seite steht die Koalitionsbetätigungsfreiheit der Gewerkschaft, die es ihr ermöglicht, Arbeitnehmer über Mitgliedschaft und Leistungen zu informieren. Auf der anderen Seite müssen jedoch die Grundrechte des Arbeitgebers – insbesondere seine wirtschaftliche Betätigungsfreiheit (Art. 14 und Art. 12 Abs. 1 GG) – sowie der Schutz der Arbeitnehmerrechte berücksichtigt werden.
Die Herausgabe der E-Mail-Adressen oder die Bereitstellung eines Zugangs zu internen Netzwerken hätte laut BAG erhebliche Eingriffe in die Rechte des Arbeitgebers bedeutet. Auch die Arbeitnehmer selbst sind durch ihre informationelle Selbstbestimmung (Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG) geschützt, da ihre persönlichen Daten nicht ohne ihre Einwilligung weitergegeben werden dürfen.
Koalitionsfreiheit in der digitalen Arbeitswelt
Das BAG hat betont, dass die Gewerkschaften nicht völlig ohne digitale Möglichkeiten dastehen. Sie können Arbeitnehmer beispielsweise direkt im Betrieb ansprechen und deren Einwilligung zur Nutzung ihrer dienstlichen E-Mail-Adressen einholen. Eine solche Vorgehensweise stellt laut Gericht den schonendsten Ausgleich zwischen den kollidierenden Interessen dar.
Die Gewerkschaft argumentierte jedoch, dass dies in einer immer digitaleren und mobileren Arbeitswelt nicht mehr praktikabel sei. Viele Beschäftigte arbeiten heutzutage hybrid oder vollständig remote und sind nur selten vor Ort. Gerade in solchen Szenarien sei der Zugang zu digitalen Kommunikationskanälen essenziell, um die Koalitionsfreiheit effektiv ausüben zu können. Dieser Argumentation folgte das BAG jedoch nicht, sondern verwies die Verantwortung an den Gesetzgeber.
Die Bedeutung des Urteils für Unternehmen und Gewerkschaften
Das Urteil hat weitreichende Implikationen sowohl für Arbeitgeber als auch für Gewerkschaften. Unternehmen sind nicht verpflichtet, ihre internen Kommunikationskanäle oder E-Mail-Systeme für gewerkschaftliche Zwecke zu öffnen. Gleichzeitig zeigt der Fall jedoch auch die Herausforderungen, vor denen Gewerkschaften in der modernen Arbeitswelt stehen.
Die Entscheidung des BAG ist ein Signal, dass die digitale Arbeitswelt neue rechtliche Rahmenbedingungen erfordert. Dabei geht es nicht nur um Gewerkschaftsrechte, sondern auch um den Schutz der Grundrechte aller Beteiligten – Arbeitgeber, Arbeitnehmer und Gewerkschaften.
Exkurs: Zugang zu E-Mail-Adressen über den Betriebsrat?
Unabhängig vom in diesem Beitrag behandelten Urteil könnte der folgende konstruierte Fall von Interesse sein:
Die Gewerkschaft möchte die E-Mail-Adressen aller Mitarbeitenden erhalten, um Mitgliederwerbung zu betreiben, was der Arbeitgeber jedoch ablehnt. In der Folge möchte der Betriebsrat diese Daten selbst anfordern, um sie an die Gewerkschaft weiterzugeben. Doch wie verhält es sich in diesem Fall mit den datenschutzrechtlichen Bestimmungen?
Im vorliegenden Fall gibt es mehrere datenschutzrechtliche Hürden:
- Rechtliche Grundlage für die Übermittlung von E-Mail-Adressen
- Verantwortlichkeit des Betriebsrats
Der Arbeitgeber ist grundsätzlich nur dann berechtigt, die E-Mail-Adressen der Mitarbeitenden zu verwenden, wenn eine ausdrückliche Einwilligung der Betroffenen vorliegt oder eine andere rechtliche Grundlage besteht. In diesem Fall liegt jedoch keine Einwilligung vor. Zudem sind die E-Mail-Adressen für die bloße Mitgliedswerbung nicht unbedingt erforderlich, und es besteht keine gesetzliche Verpflichtung, diese Informationen bereitzustellen. Der Arbeitgeber darf die E-Mail-Adressen daher nicht ohne Weiteres an den Betriebsrat übermitteln.
Der Betriebsrat ist gemäß § 79a BetrVG verpflichtet, den Datenschutz zu wahren. Das bedeutet, dass die Verarbeitung personenbezogener Daten – wie hier die E-Mail-Adressen – einer rechtlichen Grundlage bedarf. Auch hier wird es an einer solchen rechtlichen Grundlage mangeln, da weder eine Einwilligung vorliegt noch ein überwiegendes Interesse an der Verarbeitung der Daten bejaht werden kann.
Fazit: Der Betriebsrat könnte in diesem konstruierten Fall die E-Mail-Adressen der Mitarbeitenden nicht ohne Weiteres vom Arbeitgeber anfordern, um sie an die Gewerkschaft weiterzugeben, da die erforderliche rechtliche Grundlage fehlt.
Handlungsempfehlungen aus Datenschutzsicht
Das Urteil des BAG unterstreicht die Relevanz datenschutzrechtlicher Aspekte in diesem Zusammenhang. Unternehmen sollten die folgenden Empfehlungen berücksichtigen, um datenschutzkonform zu handeln:
- Klare Richtlinien für die Weitergabe von Daten
- Einwilligungen einholen
- Datensparsamkeit umsetzen
- Transparenz schaffen
- Schutz der internen Kommunikationssysteme
- Schulungen durchführen
Arbeitgeber sollten interne Richtlinien entwickeln, die festlegen, unter welchen Bedingungen und an wen personenbezogene Daten wie E-Mail-Adressen weitergegeben werden dürfen. Dies sollte im Einklang mit der DS-GVO stehen.
Möchten Gewerkschaften auf die E-Mail-Adressen der Arbeitnehmer zugreifen, ist die Einwilligung der betroffenen Personen erforderlich. Unternehmen sollten sicherstellen, dass solche Einwilligungen freiwillig, spezifisch und informiert erfolgen.
Arbeitgeber sollten die Datenverarbeitung auf das notwendige Maß beschränken. Eine flächendeckende Weitergabe von E-Mail-Adressen ohne konkreten Anlass widerspricht dem Prinzip der Datensparsamkeit.
Es ist wichtig, die betroffenen Arbeitnehmer klar darüber zu informieren, welche Daten verarbeitet werden, zu welchem Zweck und an wen sie weitergegeben werden.
Unternehmen sollten sicherstellen, dass interne Netzwerke und E-Mail-Systeme vor unberechtigtem Zugriff geschützt sind. Eine Öffnung solcher Systeme für externe Akteure könnte Sicherheitsrisiken bergen.
Mitarbeiter im Datenschutz- und Personalbereich sollten regelmäßig geschult werden, um datenschutzrechtliche Anforderungen zu verstehen und umzusetzen.